Aquathermie
Mittels Aquathermie kann die in Gewässern, Trink- oder Abwasser enthaltene Wärme zum Heizen oder Kühlen genutzt werden. Da das Wasser durch Sonne oder Umwelt auf natürliche Weise erwärmt wird, ist Aquathermie erneuerbar. Dieser Steckbrief gibt einen Überblick und verweist auf weiterführende Informationen rund um die Technologie.
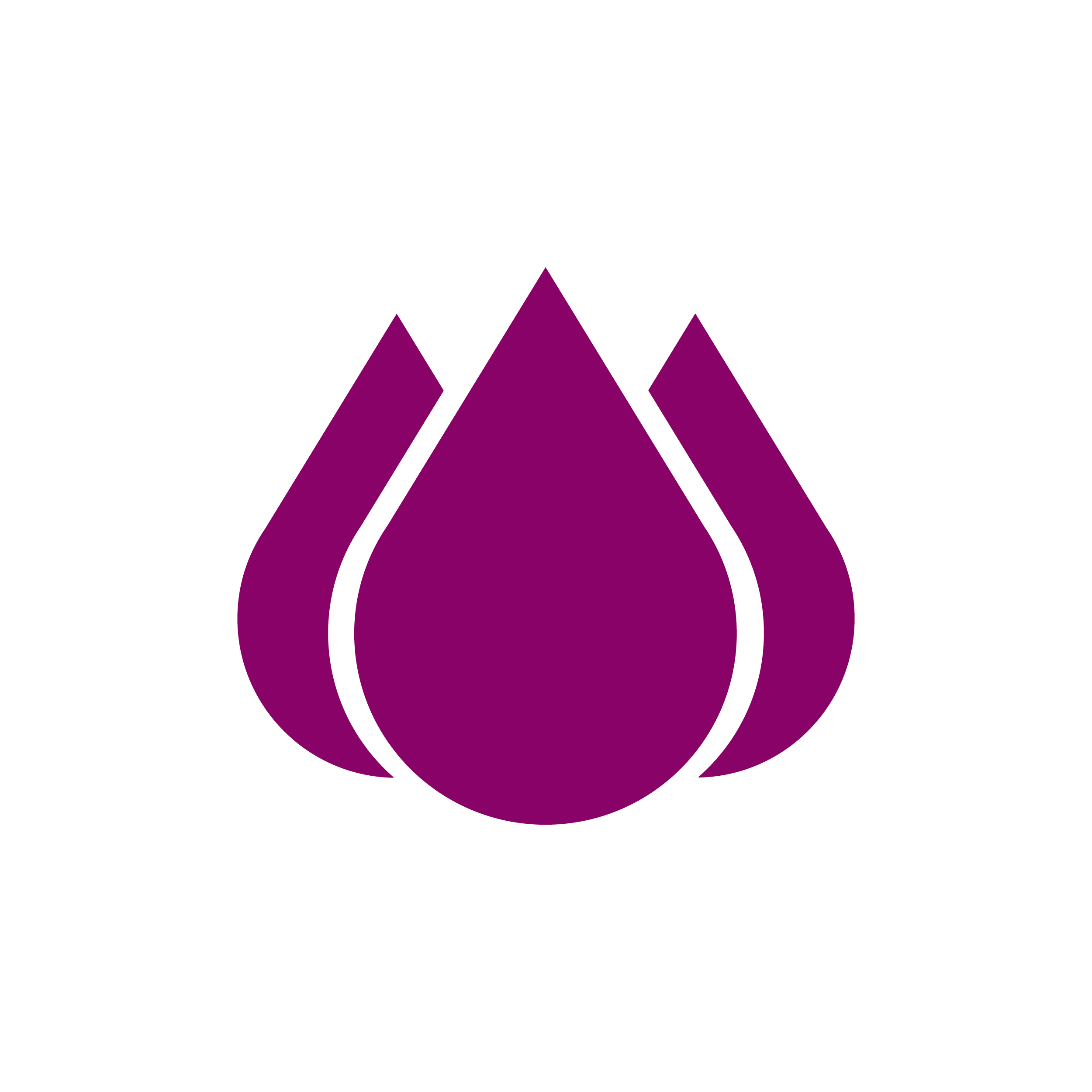
Definition
Aquathermie ist thermische Energie aus Wasser. Es bezeichnet die Methode, die im Wasser enthaltene Wärme zum Heizen oder zum Kühlen zu nutzen. Dafür können verschiedene Quellen wie beispielsweise oberflächennahe Gewässer, Seen, Flüsse, Trinkwasser oder auch Abwasser dienen. Vorteil ist neben der hohen Verfügbarkeit die ebenfalls hohe spezifische Wärmekapazität des Wassers. Das heißt, es kann verhältnismäßig viel Wärme im Medium Wasser gespeichert werden. (Vgl. Bundesverband Geothermie 2023)
Aquathermie gilt als erneuerbare Wärmequelle, da die in natürlichen Gewässern gespeicherte Wärme in der Regel aus Solarenergie oder anderen Umwelteinflüssen stammt. Grundsätzlich kann es sich bei der Wärme jedoch auch um ein Nebenprodukt der Warmwasseraufbereitung handeln, sodass dabei von Abwärme gesprochen wird. (Vgl. Task Force Wärmewende)
Da das Temperaturniveau, insbesondere von oberflächennahen Gewässern (TEO), typischerweise sehr gering ist, wird für die Nutzung von Aquathermie zu Heizzwecken eine Wärmepumpe und/oder ein Wärmetauscher benötigt. Wird die Wärmepumpe mit erneuerbarem Strom betrieben, ist die Nutzung von Aquathermie im Betrieb emissionsfrei.
Primäre Wärmequellen sind natürlich oder erneuerbar vorkommende Umwelt-Energien. Aus diesen Energiequellen kann Wärme gewonnen werden (zum Beispiel Aqua- oder Geothermie) oder sie bilden die Grundlage für sekundäre Wärmequellen (zum Beispiel bei der Umwandlung von Biomasse in Biogas).
Arten von Aquathermie
In der Aquathermie werden drei verschiedene Formen unterschieden: thermische Energie aus Oberflächenwasser (TEO), aus Abwasser (TEA) und aus Trinkwasser (TET).
-
Thermische Energie aus Oberflächenwasser (TEO) wie beispielsweise aus Flüssen, Kanälen oder Seen kann durch Wärmetauscher und insbesondere Wärmepumpen trotz des eher geringen Temperaturniveaus hocheffizient genutzt werden. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, welchen Einfluss eine Entnahme von Wärme auf die Tier- und Pflanzenwelt des Gewässers haben kann. Bei großen Gewässern wird jedoch grundsätzlich angenommen, dass dies keinen signifikanten ökologischen Einfluss auf das Gesamtsystem nimmt (vgl. Projektgruppe Seethermie 2021). Um die Wärme aus dem Gewässer zu ziehen, wird das Wasser in einen Wärmetauscher geleitet, um dort einen Großteil der Wärme an ein Speichermedium (zum Beispiel das Kältemittel der Wärmepumpe) zu übertragen. Mittels Wärmepumpe kann dann das Trink- oder Nutzwasser auf das benötigte Temperaturniveau gebracht und direkt in Häusern genutzt oder in ein Wärmenetz eingespeist werden. (Vgl. Tilia 2022) Detaillierte Informationen zur Funktionsweise von Wärmepumpen finden Sie hier.
Darüber hinaus ist die Nutzung in Kombination mit einem Wärmespeicher möglich. In diesem Fall wird die Wärme beispielsweise in einem Wärme-Kälte-Speicher im Boden gespeichert. In den Sommermonaten kann diese Wärme aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder entnommen werden. Entsprechend umgekehrt kann Winterkälte in der Erde gespeichert und zur Kühlung im Sommer genutzt werden. (Vgl. Task Force Wärmewende) Grundsätzlich sind Saisonalspeicher für Wärmenetze meistens Erdbeckenspeicher – an sich kann aber jeder Speicher angeschlossen werden. Für den Sommer wäre ebenso ein kleiner Heimspeicher denkbar, wenn sich ein wirtschaftliches Szenario dafür ergibt.
-
Bei der thermischen Energie aus Abwasser (TEA) wird die Wärme aus dem Kanalisationswasser zur Gebäudebeheizung genutzt. Die Nutzung von Abwasser ist insbesondere deshalb interessant, da Abwasserströme (zum Beispiel aus industriellen Anlagen) in der Regel über ein deutlich höheres Temperaturniveau verfügen als natürliche Gewässer.
- Bei der thermischen Energie aus Trinkwasser (TET) wird die Wärme dem Trinkwasser entzogen.
Eng verwandt mit der Aquathermie ist zudem die Hydrothermie. Dort wird die Wärme nicht einem oberflächennahen Gewässer, sondern einem warmen Grundwasservorkommen entzogen. Dies hat den Vorteil, dass Grundwasser typischerweise über deutlich höhere und saisonal weniger stark fluktuierende Temperaturniveaus verfügt.
Zentrale oder dezentrale Versorgung
Meist wird für die Nutzung von Aquathermie ein Wärmenetz eingesetzt. Auf zentraler Ebene kann die Wärmeenergie in das kommunale Netz eingespeist werden. Auf dezentraler Ebene können einzelne Gebäude direkt versorgt werden. Die Wärmeversorgung von mindestens zwei bis maximal 16 Gebäuden wird durch ein Gebäudenetz sichergestellt. (Vgl. BAFA 2024)
Weiterführende Informationen
Quellen
Bundesverband Geothermie: Aquageothermie – Aquathermie. Zuletzt bearbeitet Oktober 2023. https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/a/aquageothermie-aquathermie#:~:text=Die%20Aquathermie%20nutzt%20die%20im,%2C%20Seen%2C%20oder%20auch%20Abwasser, Zugriff am: 3. März 2025.
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Merkblatt zur Antragstellung für die Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes und für den Anschluss an ein neu zu errichtendes Gebäudenetz beim BAFA. 1. Januar 2024. https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_merkblatt_antragstellung_wnet_gnet.html, Zugriff am: 3. März 2025.
Projektgruppe Seethermie: Innovative Wärmeversorgung aus Tagebauresten. Schlussbericht. Kurzfassung. 23. Juli 2021. https://transformationsregion-mitteldeutschland.com/wp-content/uploads/2021/07/20210723_Schlussbericht-Seethermie_Kurzfassung.pdf, Zugriff am 17. März 2025.
Task Force Wärmewende: Aquathermie. O. D. https://taskforce.wiefm.eu/wissensdatenbank/aquathermie/, Zugriff am: 3. März 2025.
Tilia: Wärme-/Kältegewinnung aus einem Oberflächenwasser. Erzeugung und Speicherung von Wärme. Januar 2022. https://tilia.info/wp-content/uploads/2022/01/Aquathermie.pdf, Zugriff am: 3. März 2025.
Technologien für die Kommunale Wärmewende
Erkunden Sie weitere Wärmewendetechnologien.
